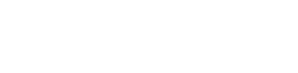Articles
Testimonies in German
We have a lot to tell each other
Von 1950 bis 1952 besuchte ich die Wesselbachschule, eine Volksschule, in Hohenlimburg/Westfalen. Diese Klasse hatte damals etwa 50 Schülerinnen und Schüler. Aufgrund der Initiative eines ehemaligen Klassenkameraden fanden in all den Jahren Klassentreffen statt. Das letzte Treffen 2019 fand mit 20 Ehemaligen statt. Das geplante Treffen für 2020 musste wegen Corona ausfallen. So kam mein ehemaliger Schulkamerad Hans-Hermann Krieger, der damals in der Schule direkt vor mir saß, auf eine gute Idee. Jeder sollte einmal aus seinem Leben berichten – Lustiges, Erfreuliches, Leidvolles, was auch immer – er würde dann alles drucken lassen und in einer DIN-A4-Broschüre herausgeben und dann an jeden versenden. Erfreulicherweise haben sich 20 der Ehemaligen mit ihren sehr unterschiedlichen Lebensläufen in einem Bericht geäußert. Den folgenden Text hatte ich beigesteuert. Es war mir ein Anliegen, auch von meiner Glaubensentscheidung zu berichten und die früheren Mitschülerinnen und Mitschüler ebenfalls einzuladen.
Werner Gitt
Wir haben uns viel zu erzählen
Von Werner Gitt
Die meisten von Euch haben gemeinsame acht Jahre in der Wesselbachschule im selben Klassenverband verlebt. Ich kam erst 1950 in unsere Klasse, und ihr habt den Neuling freundlich aufgenommen. Unser lieber Hans-Hermann Krieger hatte eine gute Idee, indem er anregte, jeder solle doch einmal besondere Erlebnisse aufschreiben. So bin ich gerne bereit von mancherlei Hoch- und Tiefpunkten meines Lebens zu berichten.
Ich wurde am 22. Februar 1937 in Raineck (Kr. Ebenrode) im nördlichen Ostpreußen geboren, das nach dem Krieg zu Russland gehört. Das Dorf hatte damals 133 Einwohner und war nur 15 Kilometer von der litauischen Grenze entfernt. Ich verbrachte eine schöne und unbeschwerte Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof. Soweit ich mich erinnern kann, waren heiße Sommer und kalte Winter mit sehr viel Schnee damals das Normale. Wenn es einmal so heftig regnete, dass der Hof überflutete, dann schwammen die meterlangen Futtertröge für die Enten und Gänse auf dem „Hofsee“ und wurden von mir sogleich als Ruderboot genutzt.
Oft strolchte ich auf der Wiese umher, die an den Bauernhof grenzte und zu der auch ein Teich gehörte. Der Teich versorgte die Kühe mit dem notwendigen Trinkwasser, und die Enten schnäbelten im Wasser nach allerlei Essbarem. Tauchte ich im Sommer hier auf und ging dann zurück in Richtung Hof, verließen alle Enten schlagartig den Teich und folgten mir im Entenmarsch. Sie hatten sich gemerkt, dass nun bald der Tisch für sie reich gedeckt würde, denn auf dem Hof angekommen, eilte ich zum Getreidespeicher, um mit reichlich Körnern zurückzukommen. So wurde ich zum Liebling der Enten.
Ganz anders beurteilten mich die Hühner. Manchmal öffnete ich die Tür des Hühnerstalles, nachdem das Federvieh sich bereits auf den Stangen zum Schlafen eingefunden hatte. Mein lauter Schrei „Husch, husch!“ unterbrach die Ruhe, und alle Hühner flatterten wild im Stall umher. Was ich als Gaudi empfand, war für die Hühner weniger zum Lachen. So galt ich bei ihnen wahrscheinlich als der Hühnerschreck.
Bei uns auf dem Land wurde ausschließlich Platt gesprochen, und so kannte ich kein einziges Wort Hochdeutsch, als ich im Sommer 1943 eingeschult wurde. Die Rainecker Dorfschule hatte, wie es damals auf dem Lande so üblich war, nur ein einziges Klassenzimmer, in dem die Schüler aller acht Klassen gleichzeitig unterrichtet wurden. Als ich eingeschult wurde, hatte mein acht Jahre älterer Bruder Fritz (1929-1945) bereits die Rainecker „Bildungsstätte“ durchlaufen und arbeitete als angehender Bauer auf unserem Hof.
Obwohl sich Deutschland zur Zeit meiner Einschulung bereits im vierten Kriegsjahr befand, lebten wir nach meinem Empfinden in Ostpreußen immer noch wie im tiefsten Frieden. Etwas Neues war jedoch hinzugekommen: In der Schule wurde ständig irgendeine Sammlung durchgeführt – mal waren es Kräuter, dann wiederum Lumpen oder Tierknochen. Eines Tages, ich ging noch nicht zur Schule, sollten Knochen gesammelt werden. Mutter hatte meinem Bruder ein Päckchen zusammengestellt, das er aber vergessen hatte mitzunehmen. So beauftragte sie mich, dieses zu der nahegelegenen Schule zu bringen. Ich machte mich auf den Weg, öffnete die Tür des Klassenzimmers, ging direkt auf den Tisch des Lehrers zu, und legte dort das Knochenpaket ab. Dies tat ich – natürlich auf Platt – mit den Worten: „Eck bring dem Fretz sine Knoakes.“ (Ich bringe die Knochen von Fritz). Ich verstand nicht, warum die ganze Klasse in schallendes Gelächter ausbrach.
Bis zu dieser Zeit erlebte ich eine schöne und unbeschwerte Kindheit in ländlich-bäuerlichem Umfeld. Aber bald sollte sich Vieles ändern. Die jungen Bauern waren bereits zum Krieg eingezogen, so dass auf den meisten Höfen nur noch Frauen und alte Männer wirtschafteten. Da mein Vater handwerklich sehr geschickt war, wurde er zum Ortsbauernführer gewählt und darum uk gestellt. Mit diesem „unabkömmlich“ war er vom Wehrdienst befreit mit der Auflage, auch den anderen Bauern zu helfen, damit der Fortbestand der Landwirtschaft gesichert war.
In jener Zeit war es gefährlich, sich kritisch zum Naziregime zu äußern, was mein Vater nicht immer beachtete. Eines Tages wurde er von dem Knecht eines Nachbarn angezeigt mit den Worten: „Der Gitt ist politisch nicht zuverlässig.“ Bald darauf erschien ein Beauftragter der Partei zur Überprüfung. Als er auf den Hof kam, begrüßte er meinen Vater mit einem lautstarken „Heil Hitler!“ Darauf mein Vater: „Ich bin nicht der Hitler!“ – „Da haben wir es ja schon“, stellte der Parteibeauftragte sofort fest. Schon wenige Tage danach wurde die uk-Stellung aufgehoben und der Gestellungsbefehl zur Wehrmacht folgte. Mein Vater kam damit als Soldat nach Frankreich und wurde an der Atlantikküste bei St. Nazaire zur Küstenbeobachtung eingesetzt. Dies war eine gute Fügung, denn während des ganzen Krieges gab es dort keinerlei kriegerische Handlungen. Wäre er in Ostpreußen geblieben, hätte er unausweichlich zum Volkssturm gemusst, und diese Männer sind fast ausnahmslos gefallen.
Flucht vor der Roten Armee
Im Oktober 1944 rückte die Rote Armee bis an die ostpreußische Grenze vor. So mussten auch wir die Flucht ergreifen. Ich war damals sieben Jahre alt und gerade in die zweite Klasse der Dorfschule gekommen. Wir flüchteten mit Pferd und Wagen; mein Großvater hatte einen Erntewagen zum Fluchtwagen umgebaut, und so gelangten wir damit bis nach Südostpreußen, wo ich auch wieder zur Schule ging.
Eines Tages schritt ein älterer Mann eilig durchs Dorf und gab seine amtliche Bekanntmachung von Haus zu Haus weiter. Es war der 22. Januar 1945, das Thermometer war auf etwa 25 bis 30 Grad unter Null gefallen. Kurz und knapp rief er aus: „Die Russen kommen, rette sich, wer kann!“ Nun war die Aufregung groß. Schnell wurden die wenigen Habseligkeiten auf zwei Wagen geladen, die Pferde angespannt und los ging es in Richtung Westen. Ein Wagen wurde von meiner Mutter gelenkt, der andere von meiner Tante Lina.
Wegen der bald verstopften Straßen kamen wir nur sehr langsam voran. Zwei Nächte mussten wir bei eisiger Kälte auf dem beidseitig offenen Planwagen verbringen. Vor einem etwas größeren Ort wurde der Treck von der Roten Armee gestoppt. Russen gingen von Wagen zu Wagen. Mein Bruder Fritz, damals 15 Jahre alt, wurde mitgenommen. Was würde mit ihm geschehen? Tiefe Angst befiel uns. Wir waren über Nacht zu Rechtlosen geworden, mit denen man machen konnte, was man wollte. Weil man den Jungens unterstellte, dass sie der Hitlerjugend angehörten, wurden sie kurzerhand erschossen.
Wir kehrten wieder zurück nach Peterswalde, von wo aus wir aufgebrochen waren. Uns bot sich ein Bild des Gräuels und der Verwüstung: Tote Menschen und Pferde lagen am Straßenrand, Häuser waren abgebrannt. Es begann eine schreckliche Zeit, denn der sowjetische Diktator Stalin hatte den Soldaten erlaubt, sieben Tage lang alles zu tun, was sie nur wollten. So waren Raub, Plünderung und Vergewaltigung an der Tagesordnung.
Eines Tages ging ein Russe durchs Dorf von Haus zu Haus und forderte alle Einwohner auf, zum Dorfplatz zu kommen. Es bildete sich schnell eine lange Schlange, in der sich auch meine Mutter, ihre Schwester Lina, unsere Hausangestellte Meta und ich befanden. Rena war schon einige Tage zuvor von russischen Offizieren abgeholt worden, um in deren Quartier für sie zu kochen. Die vorbeiziehende Schlange bewegte sich auch an diesem Haus vorbei. Plötzlich entdeckten wir Rena mit einem Russen auf der Treppe eines Hauses. Renas Mutter, also meine Tante Lina, wurde aus der Schlange herausgeholt und schnell in das Haus gebracht. Auch meine Mutter aus der Menschenmenge herauszuholen, wurde abgelehnt mit den Worten „Eine ist genug!“ Nun war klar, das ganze Vorhaben hatte nichts Gutes zu bedeuten.
Auf dem Dorfplatz angekommen, wurden noch arbeitsfähige Frauen aussortiert. Wir Kinder wurden gewaltsam von unseren Müttern getrennt. Wir ahnten nicht, dass dies der Tag sein sollte, an dem wir unsere Mütter zum allerletzten Mal sahen. Mit anderen Frauen, die als arbeitsfähig angesehenen wurden, darunter auch Meta, trieb man sie nun zu Fuß in Richtung des nächsten Dorfes. So etwas Schreckliches hatte ich bisher noch nicht erlebt. Man hatte mir in herzloser Weise die Mutter genommen. Niemand kam mehr zurück, und so wurde uns klar, es handelte sich um eine Verschleppung ins entfernte Russland. Erst nach Jahren erfuhren wir von einer Augenzeugin, dass meine Mutter schon im April 1945 in der Ukraine gestorben war. Sie starb in den Armen dieser Zeugin mit den Worten: „Was wird nur aus meinem kleinen Werner werden?“ Jetzt weiß sie es!
Im Laufe des Sommers bekamen wir zusätzliche Mitbewohner auf „unserem“ Hof. Eine polnische Frau mit ihren fünf Kindern zog bei uns ein. Auch sie waren Vertriebene, denn sie kamen aus jenem östlichen Teil Polens, der an die Sowjetunion abgetreten werden musste.
Vertreibung
Im Oktober 1945 begann die Vertreibung der Deutschen durch die Polen. Am 29. Oktober 1945 wurden wir mit dem Fuhrwerk eines Polen nach Osterode in die Nähe des Bahnhofs gebracht. Auf dem Hof vor einem Getreidespeicher verbrachten wir mit vielen anderen die Nacht im Freien auf dem Kopfsteinpflaster. Am anderen Morgen starb dort mein Großvater, den wir, ohne ihn beerdigen zu können, liegen lassen mussten, denn der Zug, der ausschließlich aus Viehwaggons bestand, stand schon zu unserem Abtransport nach Westen bereit. Von Raineck aus waren wir im Oktober 1944 mit fünf Personen aufgebrochen. Opa war nun schon der vierte, der nicht überlebte. War ich nun der nächste, auf den der Tod zukam?
Was wir mitnehmen durften, war streng reglementiert: nur das, was wir am Leibe tragen konnten und was in einem Marmeladeneimer Platz hatte. In einer zehntägigen strapaziösen Tour erreichten wir nach häufigen und oft langen Stopps das stark zerstörte Berlin. Diese Bahnfahrt ist mir in schrecklicher Erinnerung geblieben. Manche ältere Leute starben während dieser Tortur in der Kälte und ohne Versorgung. Dann öffnete man die Waggontür und warf die Leichen ins Freie. Von Berlin aus ging die Fahrt über Rostock in das 16 Kilometer östlich gelegene Sanitz, wo wir bei einer Familie einquartiert wurden.
Unvergesslich ist mir folgende dramatische Situation: Einige Frauen hatten sich weit vom Zug entfernt, um nach etwas Essbaren auf den Feldern zu suchen. Plötzlich setzte sich der Zug ohne jegliche Vorwarnung in Bewegung. Die Frauen kamen nicht rechtzeitig zurück. Nun war die Not für die Angehörigen im Viehwaggon groß. Würden sie ihre Zurückgebliebenen jemals wiedersehen? Was könnte man tun? Mir ist in Erinnerung, dass das Vater-Unser gebetet wurde. Nach etlichen Tagen hörten wir, dass die Vermissten mit einem späteren Zug mitgenommen wurden. Gott hatte das Gebet der Not erhört.
Unfreiwillige Endstation Föhr
In Sanitz erfuhren wir, dass mein Cousin Waldemar (*1925) bei einem Bauern in der Nähe von Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) untergekommen war. Im Rahmen der Familienzusammenführung bot sich nun die Chance, die Russische Zone zu verlassen. Bald schon wurde ein Zug bereitgestellt, der außer uns noch viele andere westwärts befördern sollte. Unabhängig von der Zielangabe wurden alle auf die Insel Föhr verfrachtet. Dort wurden wir – meine Tanten Lina und Marie, meine Cousine Rena und ich – bei einem schon sehr alten Ehepaar einquartiert. Wegen Überfüllung des Hauses durch andere Flüchtlinge blieb für uns nur noch eine kleine Abstellkammer unter dem Dach übrig. Sie hatte kein Fenster, dafür aber eine kleine Luke, die uns immerhin anzeigte, ob es Tag oder Nacht war.
In Wyk begann für mich nach langer Zeit auch wieder der Schulunterricht. Zwecks Einstufung in die richtige Klasse musste ich einen Text lesen. Nach über einem Jahr „Zwangsferien“ fiel dieser Test nicht gerade überzeugend aus, und so musste ich als Neunjähriger noch einmal mit den ABC-Schützen durchstarten. Diesen Rückschritt konnte ich später jedoch bequem wettmachen.
Seit Februar 1945 galt ich als Vollwaise. Meine Mutter war verschleppt worden; die letzte Nachricht von meinem Vater lag bereits einige Jahre zurück. So wurde die Annahme, dass Vater im Krieg umgekommen sei, immer wahrscheinlicher. Doch dann geschah etwas schier Unglaubliches. Meine Tante Lina erhielt von einem entfernten Verwandten aus Bochum einen außergewöhnlichen Brief. Wie es dazu kam, sehe ich als ein echtes Wunder an.
Nach Kriegsende kam mein Vater in französische Gefangenschaft, und er wusste nichts von dem Schicksal seiner Familie. Es wurde den Gefangenen gewährt, pro Monat einen Brief nach Deutschland zu schreiben. Da nahezu alle unsere Verwandten in Ostpreußen wohnten, schrieb mein Vater immer wieder dorthin, ohne je eine Antwort zu bekommen.
Eines Nachts hatte Vater im Lager einen Traum: Er traf darin einen weit entfernten Verwandten, der schon seit etlichen Jahren vor dem Krieg im Rheinland wohnte. Als sie sich verabschiedeten, lud der Verwandte meinen Vater ein mit den Worten: „Hermann, besuch mich doch mal!“ Mein Vater sagte im Traum zu und stellte noch die entscheidende Frage: „Aber wo wohnst du denn? Ich kenne doch deine Anschrift nicht.“ Der Verwandte erklärte ihm deutlich: „Bochum, Dorstener Str 134a.“ Da wachte mein Vater auf, zündete in der Nacht ein Licht an und schrieb die soeben im Traum erfahrene Adresse auf.
Den wach gewordenen Kameraden im Schlafsaal erzählte er die sonderbare Traumgeschichte. Sie verlachten ihn, weil er sie ernst nahm und sogar beteuerte, dass er dorthin schreiben werde. Welch eine Überraschung! Die Adresse war richtig, und der Brief erreichte diesen Onkel. Über ihn erfuhren wir, dass mein Vater lebte. Als er mich dann später von Föhr abholte, kam es zu einer unvergesslichen ersten Begegnung im Treppenhaus. Vater sprach mich an, ohne mich jedoch zu erkennen: „Sag mal, wohnt hier die Frau Riek?“ Ich hatte ihn sofort wieder erkannt; ging aber gar nicht auf seine Frage ein, sondern fragte ihn auf Platt: „Papa, kennst mi nich?“ So lange hatten wir uns nicht gesehen, dass er mich nicht wieder erkannte. Welch unbeschreibliche Freude, nach so langer Trennung von einem liebenden Vater umarmt zu werden.
Die Rückkehr meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft war für mich das größte Geschenk nach all den schrecklichen Kriegsereignissen. Er heirate noch einmal, so dass ich wieder ein familiäres Zuhause hatte. 1950 zogen wir in die Lennestadt Hohenlimburg, und zu diesem Zeitpunkt kam ich dann zu Euch in die 7. Klasse der Wesselbachschule.
Was meinen weiteren beruflichen und familiären Lebensweg betrifft, habe ich Euch auf einem Klassentreffen, bei dem ich nach langer Zeit erstmals wieder auftauchte, ausführlich erzählt. So will ich mich hier nicht wiederholen. Aber von einer sehr entscheidenden Wende meines Lebens möchte ich Euch doch berichten.
Ungeplante Lebenswende
Im November 1972 gab es in der Stadthalle in Braunschweig eine Großveranstaltung, bei der eine Woche lang täglich an die 2000 Personen in die Halle strömten. Es ging an jedem Abend stets um das große Thema des rettenden Evangeliums. Der Evangelist Leo Janz verstand es, die Botschaft von Jesus so in den Mittelpunkt zu stellen, dass jeder erkennen konnte, ob er nur ein Namenschrist ist, oder ob Jesus sein Leben prägt. Anders ausgedrückt: Die vollmächtige Verkündigung mündete in den allabendlichen Ruf: Triff eine Lebensentscheidung für diesen Jesus, damit du zu der Gewissheit gelangst, einmal die Ewigkeit im Himmel und nicht am verlorenen Ort zu verbringen. Ich wollte Gewissheit haben und bekam sie, indem ich mich entschloss, diesem Jesus zu folgen.
Das führte in der Folgezeit zu einem vertieften eigenen Bibelstudium. Ich konnte die Bibel in ihrer Ganzheit als Gottes Wort und damit als Wahrheit annehmen. Dadurch gewann ich viele Einsichten, die mir auch für die Beurteilung naturwissenschaftlicher Themen halfen. Information ist die entscheidende Kenngröße des Lebens, und Information kann nicht von alleine in der Materie entstehen. Mit gutem Gewissen konnte ich dem Schöpfungsbericht der Bibel in all seinen Aussagen glauben.
Im Laufe der Zeit hielt ich öffentliche Vorträge zu den mich bewegenden Themen und publizierte auch darüber. Wenn ich heute Bilanz ziehe, was meine Glaubensentscheidung zur Folge hatte, dann kann ich nur eines – und das ist Staunen. Welche Wege Gott mit mir ging, hätte ich nicht im Geringsten ahnen können. Auf allen Erdteilen war ich mit der guten Botschaft von Jesus unterwegs (z.B. viele Länder Europas, Russland, Kasachstan, Japan, Australien, Neuseeland, Südafrika, Brasilien, Paraguay, USA, Kanada). Von den 12 Büchern wurde „Fragen, die immer wieder gestellt werden“ mit 26 Auflagen und Übersetzungen in über 20 Sprachen das Bekannteste. Mein neuestes Buch hat den Titel „Der Himmel – Ein Platz auch für Dich?“.
Meine liebe frühere Mitschülerin, mein lieber früherer Mitschüler, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen recht ausführlichen Lebensbericht zu lesen. Als Kind habe ich unverhältnismäßig viel Leid sehen und erleben müssen. Es gab den Nullpunkt des Lebens ohne Eltern, ohne Besitz, ohne Heimat und darum auch ohne Hoffnung. Damals noch unwissend hat Gott mein Leben bereits gelenkt. Das habe ich aber erst so richtig erkannt, als Jesus in mein Leben trat und das Leben so geführt hat, wie ich es hier beschrieben habe. Obwohl weder geplant noch explizit gewollt, hat Gott mich offensichtlich dazu berufen, durch Wort und Schrift viele Menschen in den Himmel einzuladen. Es ist mir eine Freude, auch dich einzuladen, damit du im Himmel mit von der Partie bist.
Werner Gitt, März 2021